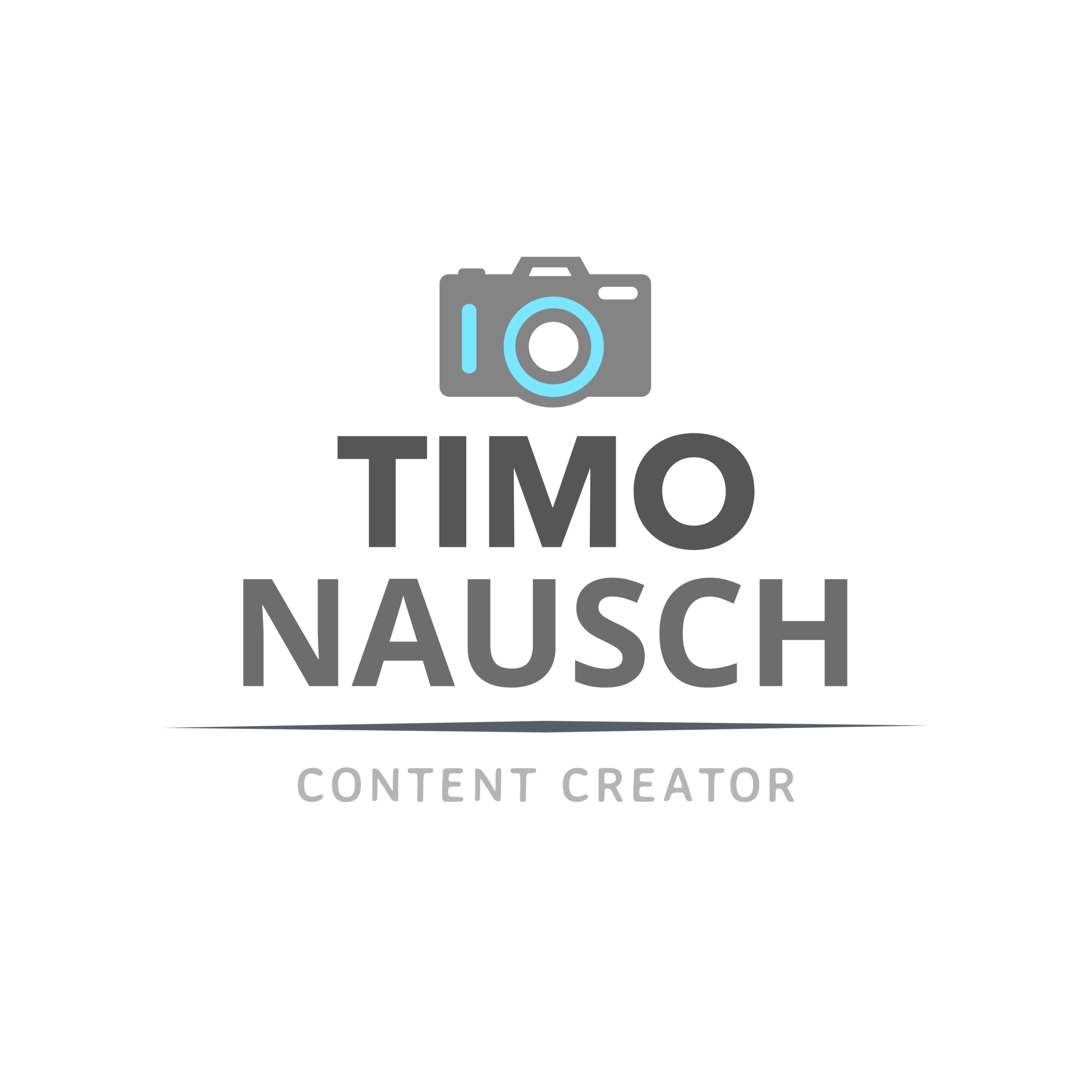5 (fast) unbekannte Streetfotografen – kennst du sie?
Ich zeige dir 5 (fast) unbekannte Streetfotografen und warum ihre Arbeiten für deine Streetfotografie Gold wert sind. Inspiration, Bildbeispiele, Kurzportraits.
Diese Streetfotografen kennt kaum jemand
1. Xyza Cruz Bacani
Xyza Cruz Bacani
Geboren 1987 in Bambang auf den Philippinen, zog sie als junge Frau nach Hongkong, um wie ihre Mutter als Hausangestellte zu arbeiten. Ein Job, der von langen Stunden, wenig Freizeit und gesellschaftlicher Unsichtbarkeit geprägt ist. Doch genau in dieser Unsichtbarkeit begann ihre Reise als Fotografin.
Mit dem Geld, das sie sich von ihrer Arbeitgeberin lieh, kaufte sie sich ihre erste Kamera – ein Schritt, der nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das vieler anderer verändern sollte.
Bacani begann, auf den Straßen Hongkongs zu fotografieren: das Leben der Migrantinnen, die Schattenseiten der glänzenden Metropole, Proteste, aber auch die leisen Momente des Alltags.
Ihre frühen Schwarz-Weiß-Aufnahmen haben eine Klarheit und Direktheit, die an große Street-Fotografen erinnert – oft wird sie mit Vivian Maier verglichen. Xyza selbst lehnt diesen Vergleich ab, weil sie ihre eigene Stimme gefunden hat.
Was ihre Arbeit so besonders macht, ist die Verbindung von Street Photography mit sozialem Engagement. Ihre Bilder sind keine reinen ästhetischen Beobachtungen, sondern gelebte Erfahrung.
Sie erzählen von Migration, Arbeitsmigration, Ausbeutung – aber auch von Würde, Hoffnung und Gemeinschaft. Dieses Spannungsfeld zwischen Dokumentation und persönlicher Geschichte zieht sich durch ihr gesamtes Werk.
Xyza Cruz Bacani
Xyza Cruz Bacani
Inzwischen lebt Xyza in New York, hat ihren Master in Arts Politics an der NYU gemacht und zählt zu den international anerkannten Stimmen der zeitgenössischen Fotografie.
Sie ist Fellow der Magnum Foundation, hat Stipendien vom Pulitzer Center und der Open Society Foundation erhalten und wurde von BBC, Forbes und Asia Society ausgezeichnet.
Ihr Fotobuch We Are Like Air* ist ein eindrucksvolles Zeugnis migrantischen Lebens und macht spürbar, wie vielschichtig und universell die Erfahrung von „Heimatlosigkeit“ sein kann.
Xyza Cruz Bacani
Was mich an Xyza Cruz Bacani fasziniert, ist die Konsequenz, mit der sie ihre persönliche Geschichte in eine universelle Sprache übersetzt hat.
Ihre Fotos wirken rau, direkt, manchmal unbequem – aber immer ehrlich. Sie erinnert uns daran, dass Street Photography mehr sein kann als das „schöne Spiel mit Licht und Schatten“. Sie kann politisch sein, ein Werkzeug für Sichtbarkeit, für Gerechtigkeit.
2. Takuma Nakahira
Takuma Nakahira
Wenn man über die Geschichte der japanischen Street- und Dokumentarfotografie spricht, kommt man an Takuma Nakahira (1938–2015) kaum vorbei. Und doch ist er außerhalb von Fachkreisen oft weniger bekannt als sein enger Weggefährte Daidō Moriyama. Dabei war Nakahira einer der radikalsten Köpfe, jemand, der Fotografie nicht einfach als Abbild verstand, sondern als ein Mittel, das Denken selbst herauszufordern.
Nakahira kam ursprünglich gar nicht aus der Kunst, sondern studierte Spanisch in Tokio. Über seine Arbeit als Redakteur beim linken Kulturmagazin Gendai no me (Contemporary View) kam er in Kontakt mit Shōmei Tōmatsu – und dieser öffnete ihm die Tür zur Fotografie. Schon kurz darauf war Nakahira Mitbegründer von Provoke, jener legendären Zeitschrift, die Ende der 1960er Jahre die japanische Fotografie einmal auf links drehte.
Was Nakahira zusammen mit Moriyama und anderen entwickelte, wurde bald berüchtigt als are, bure, boke – also grobkörnig, verwackelt, unscharf. Ein Stil, der das „Schöne“ bewusst verweigerte und stattdessen die rohe Wahrnehmung des Moments in den Vordergrund stellte. Kritiker verspotteten diese Fotos als schlampig, doch genau darin lag ihr Programm: In einer Welt voller Unsicherheit, Proteste und gesellschaftlicher Umbrüche könne eine Fotografie, die vorgibt, klar und geordnet zu sein, nur lügen.
Takuma Nakahira
Takuma Nakahira
Sein Fotobuch „For a Language to Come“ (1970) gilt bis heute als Schlüsselwerk: düstere, poetische Stadtlandschaften, die eher Gefühle und Zustände transportieren als dokumentieren. Wer dieses Buch in der Hand hat, spürt sofort, dass Fotografie hier nicht als Beweis dient, sondern als eine Sprache, die noch erfunden werden muss.
Interessant ist, dass Nakahira sich nie auf seinen Erfolgen ausruhte. Kaum war das bure-boke populär geworden, wandte er sich schon wieder davon ab – weil er darin keinen Widerstand mehr sah. In Essays wie „Why an Illustrated Botanical Dictionary?“ (1973) forderte er eine ganz neue Klarheit: scharfe, farbige Bilder, fast wie in wissenschaftlichen Abbildungen. In einem symbolischen Akt verbrannte er sogar viele seiner eigenen Negative – ein radikaler Bruch mit dem, was er selbst geschaffen hatte.
1977 erlitt Nakahira einen Zusammenbruch durch Alkoholvergiftung, der ihn schwer zeichnete: Gedächtnis und Sprache gingen verloren. Doch er begann wieder zu fotografieren – diesmal stiller, hartnäckiger, fast meditativ. Serien wie „A New Gaze“ (1983) oder „Adieu à X“ (1989) zeigen diesen anderen Nakahira: weniger aggressiv, dafür tief im Alltag verankert. Immer wieder kehrte er zu denselben Orten zurück, fotografierte Details und Oberflächen, fast wie ein Ritual.
Takuma Nakahira
Takuma Nakahira
Auch wenn er selbst immer wieder an seiner Arbeit zweifelte, wurde Nakahira in den 2000er-Jahren international wiederentdeckt. Große Retrospektiven – etwa 2003 in Yokohama – machten deutlich, wie stark sein Einfluss bis heute reicht.
Für viele zeitgenössische Street-Fotografen ist er weniger ein Vorbild in Fragen des Stils, sondern in der Haltung: Fotografie nicht als hübsches Bild, sondern als eine Form von Denken, als Versuch, die Welt radikal neu zu sehen.
3. Gustavo Minas
Gustavo Minas
Wenn man mit Gustavo Minas spricht oder seine Bilder betrachtet, merkt man schnell: hier ist jemand mit richtig viel Talent und einem guten Blick für Farben am Werk..
Gustavo wurde in Cássia, einer kleinen Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, geboren. Eigentlich wollte er Journalist werden – und war es auch kurzzeitig in São Paulo. Doch die langen Schichten in einer tristen Redaktion führten dazu, dass er einen Ausgleich suchte. Den fand er auf der Straße – mit der Kamera in der Hand.
2009 begann er ein Jahr lang bei Carlos Moreira zu studieren, einem brasilianischen Meister der Street Photography. Diese Zeit hat ihn geprägt: nicht nur fotografisch, sondern auch in seiner Haltung.
Minas sog Einflüsse von Harry Gruyaert, Alex Webb oder Gueorgui Pinkassov auf – alles Meister des Spiels mit Licht und Farbe. Schnell wurde klar: Licht & Farbe sollte das zentrale Element seiner Arbeit werden.
Gustavo Minas
Gustavo Minas
Seine Bilder entstehen meist auf den Straßen São Paulos oder in Brasília, wo er heute lebt. Gerade Letztere gilt eigentlich als „schwierige“ Stadt für Street Photography – weitläufig, leer, nicht gerade chaotisch. Doch Minas fand sein eigenes Epizentrum: die zentrale Busstation.
Seit 2015 fotografiert er dort – ein Ort voller Bewegung, Gegensätze, Geschichten. Aus diesem Langzeitprojekt entstand nicht nur internationale Anerkennung, sondern auch sein erstes Buch Maximum Shadow Minimal Light, das 2019 erschien. Später folgten Ausstellungen, unter anderem bei der Biennale in Venedig, und jüngst sogar eine Nominierung für den renommierten Leica Oskar Barnack Award.
Was seine Bilder so besonders macht? Es ist dieses feine Gespür für Licht und Reflektionen. Minas nutzt Spiegelungen, Glasscheiben oder Schatten, um Szenen fast surreal zu überhöhen – ohne dabei die Menschen aus dem Blick zu verlieren.
Gustavo Minas
Denn im Kern geht es ihm immer um das Menschliche: die Kondition des Lebens im urbanen Raum. Seine Fotografien sind deshalb oft mehr als nur hübsche Kompositionen; sie wirken wie kleine Beobachtungen über das Sein in einer Stadt.
Sein Ansatz ist bodenständig und motivierend: fotografieren, jeden Tag, egal ob auf Reisen oder in der Heimatstadt. Für ihn steckt das Außergewöhnliche nicht unbedingt im Exotischen, sondern direkt vor der Haustür.
Minas ist eigentlich immer neugierig, getrieben von Licht, Momenten und der Lust, sich selbst durch Fotografie zu verstehen.
4. Dmitry Stepanenko
Dmitry Stepanenko wurde 1987 in Odessa, Ukraine geboren – heute lebt und arbeitet er in London, wo er seit 2010 seine Leidenschaft für die Street Photography gefunden und ausgebaut hat.
Interessanterweise begann seine fotografische Reise recht unspektakulär: Nach dem Umzug in die UK wollte er schlicht seine neue Umgebung dokumentieren. Architektur, Landschaften, Kommilitonen – alles war fremd und spannend. Doch schon bald merkte er, dass ihn vor allem die Menschen in ihrer alltäglichen Umgebung fesselten. Der erste Blick auf die Werke von Henri Cartier-Bresson tat sein Übriges: Dmitry fand sein Zuhause in der Straßenfotografie.
Anfangs fotografierte er – ganz klassisch – in Schwarzweiß. Klare Formen, starke Kontraste, ein Auge für Geometrie und Komposition prägten seinen Stil.
Doch etwa 2013 kam die große Wende: Inspiriert von Ernst Haas, Alex Webb, Harry Gruyaert und Gueorgui Pinkhassov wechselte er vollständig zur Farbfotografie. Seitdem sind Farben, Licht und Reflexionen seine „Werkzeuge“, mit denen er alltägliche Szenen in poetische Bilder verwandelt.
Dmitry Stepanenko
Dmitry Stepanenko
Dmitry Stepanenko
Viele seiner Fotos haben fast etwas Malerisches oder gar Filmisches – als würde man in einen kurzen Moment eines größeren, ungeschriebenen Dramas hineinschauen.
Dmitrys Arbeiten sind international anerkannt: Er war Mitgründer des Street Collective, Co-Founder und Creative Director des London Street Photography Festival und seine Fotos wurden in Ausstellungen in Odessa, London und weltweit gezeigt.
2017 erschien sein erstes Buch Heavy Colour, ein Jahr später folgte das Zine In Bloom. Auch als Finalist, Juror und Speaker war er bei großen Festivals wie dem Miami Street Photography Festival, StreetFoto San Francisco oder dem Brussels Street Photography Festival vertreten.
Was ihn antreibt, ist das Unvorhersehbare der Straße: „Du weißt nie, was du mit nach Hause bringst, wenn du morgens losgehst“, sagt er selbst.
Dmitry Stepanenko
Dmitry verbringt oft ganze Tage auf den Straßen Londons, ohne festen Plan, immer auf der Suche nach diesem einen Moment, in dem Farben, Formen und Menschen für Sekundenbruchteile perfekt zusammenfinden. Seine Bilder wirken dabei klar und reduziert – „less is more“ gilt für ihn besonders beim Editieren. Er fotografiert viel, zeigt aber nur das, was wirklich Bestand hat.
Seine Inspiration findet er nicht nur in der Fotografie, sondern auch in Malerei, Film, Musik und Literatur. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich in seinen Bildern wider: Sie sind gleichzeitig Beobachtung und Interpretation, Dokumentation und Kunst.
Wenn man ihn fragt, was ein gutes Bild ausmacht, antwortet er: „Es sollte einen einzigartigen Moment mit einem einzigartigen künstlerischen Ansatz verbinden.“
Genau das macht seine Fotografie so stark – sie ist Beobachtung des Lebens, aber immer durch einen sehr persönlichen Filter aus Farben, Formen und Emotion.
5. Harold Feinstein
Harold Feinstein
Wenn man den Namen Harold Feinstein hört, denken viele zuerst an Coney Island. Und tatsächlich war dieser kleine Küstenabschnitt in Brooklyn über sechs Jahrzehnte hinweg so etwas wie seine große Bühne.
Geboren 1931 in Coney Island als Sohn jüdischer Einwanderer, griff er mit 15 zur Kamera – eine geliehene Rolleiflex – und ließ sie nie wieder los. Während andere Teenager noch in der Schule saßen, zog Harold bereits mit seiner Kamera los, um das Leben der Menschen um ihn herum einzufangen.
Mit 19 kaufte ihm Edward Steichen, legendärer Fotodirektor des Museum of Modern Art in New York, Bilder ab – ein Ritterschlag, der ihn als „Wunderkind der Fotografie“ bekannt machte.
Feinstein war keiner, der inszenierte oder lange plante. Er arbeitete intuitiv, schnell und voller Neugier. Seine Fotos wirken so, als hätten sie sich einfach ergeben – ein Blick, eine Geste, ein Moment mitten im Leben. Kritiker beschrieben seine Arbeit als humanistisch, nahbar, sinnlich.
Harold Feinstein
Harold Feinstein
Er hatte dieses besondere Talent, das Gewöhnliche außergewöhnlich erscheinen zu lassen. Ob lachende Kinder auf der Achterbahn, Liebespaare am Strand oder Soldaten im Koreanischen Krieg – Feinstein ging es nie um das Spektakel, sondern um die Menschlichkeit im Alltag.
Schon früh wurde er Teil der New Yorker Foto-Szene, wohnte im berühmten Jazz Loft, gestaltete Plattencover für Blue Note Records und arbeitete mit Größen wie W. Eugene Smith zusammen.
Doch mindestens ebenso prägend wie seine Bilder war sein Wirken als Lehrer. Feinstein war ein „teaching artist“ im besten Sinne: offen, herzlich, nicht elitär.
Seine Workshops standen jedem offen – vom Anfänger bis zum Profi. Namen wie Mary Ellen Mark oder Louis Draper gehörten zu seinen Schülern. Noten vergab er nie – er glaubte daran, dass Kreativität nicht bewertet, sondern entfaltet werden sollte.
Harold Feinstein
Feinsteins Karriere verlief nicht immer linear. Legendär ist seine (später bereute) Entscheidung, nicht an Steichens Weltbekannter „Family of Man“-Ausstellung im New Yorker MoMA teilzunehmen – ein Schritt, der vielleicht erklärt, warum sein Name weniger bekannt ist als der manch anderer Kollegen.
Doch sein Werk blieb vielfältig: von Street über Porträts bis zu experimenteller Scanografie, für die er in den 2000ern internationale Preise gewann. Ab 1980 fing er außerdem auch an, mit der Farbfotografie zu experimentieren.
Harold Feinstein
2011 erhielt er den Living Legend Award des Griffin Museum of Photography. Kurz vor seinem Tod 2015 erlebte er noch, wie seine Schwarzweiß-Arbeiten wiederentdeckt wurden.
Das Museum of Modern Art in New York, das Whitney oder das International Center of Photography haben seine Bilder weiterhin in den Sammlungen.
Vielleicht macht genau das seinen Zauber aus: Feinstein war kein Fotograf der großen Distanz, sondern einer der Nähe. Er liebte Menschen – und diese Liebe spürt man in seinen Bildern. Wer seine Fotos betrachtet, fühlt sich eingeladen, Teil des Moments zu werden.
Oder, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen:
„Ich habe nie aufgehört, das Leben zu lieben. Und meine Kamera war immer nur mein Weg, dieses Wunder zu teilen.“