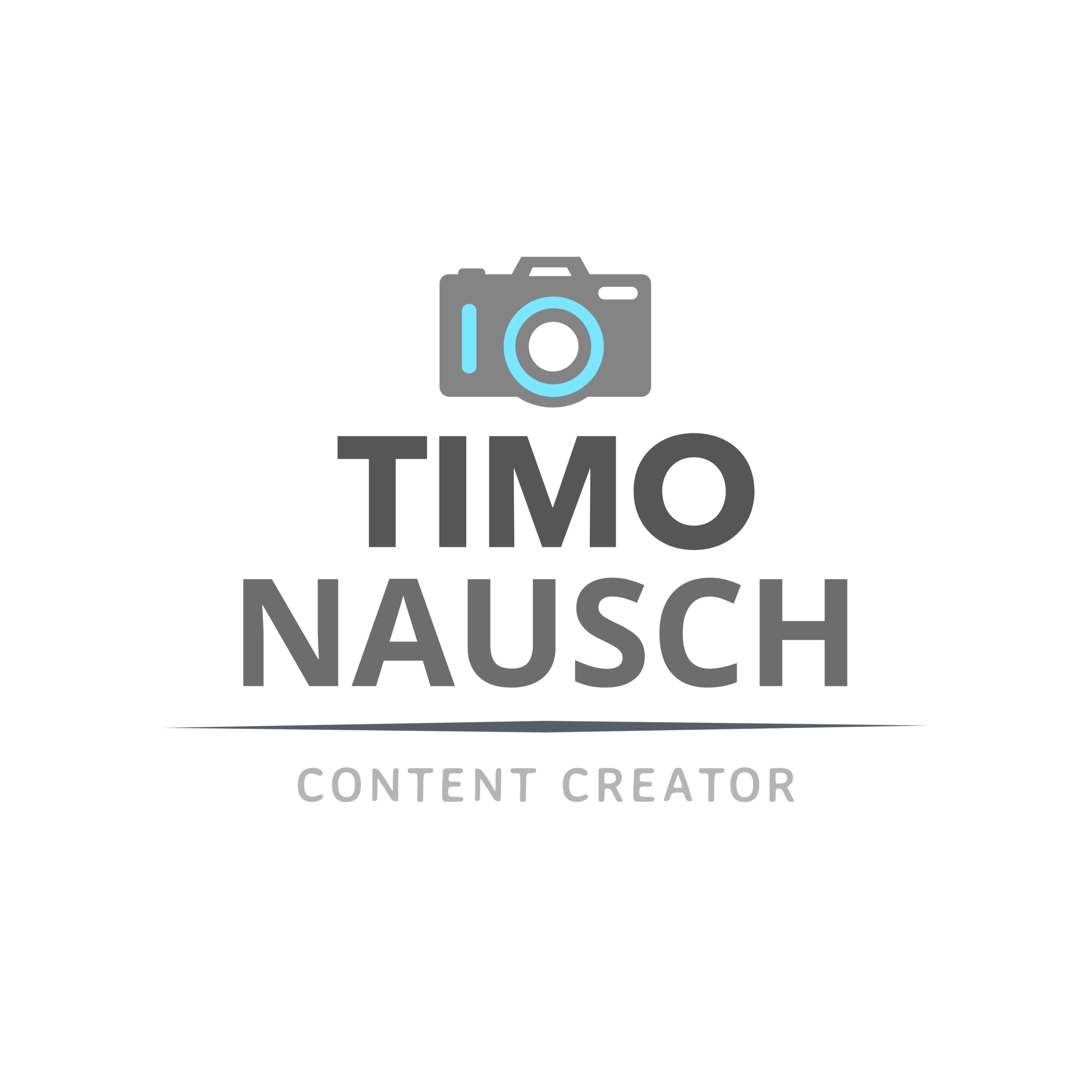Dieses Fotografie Konzept wird zu häufig ignoriert
Fotografie hat viele Faustregeln oder Konzepte. Nicht immer muss man diese strikt befolgen und die besten Fotos entstehen manchmal genau dadurch, dass man gewisse “Regeln” ignoriert.
Dennoch gibt es bestimmte Gründe, warum sich genau diese Regeln etabliert haben. Eines dieser Konzepte ist es, mit deinen gegebenen Bedingungen zu arbeiten.
Und so einfach wie das klingt sehe ich zu viele Fotografen die dieses einfache Fotografie Konzept ignorieren und das genaue Gegenteil machen. Sie arbeiten gegen ihre Umgebung oder das eigene Foto.
Hier will ich dir zeigen, auf welche Fehler du achten solltest, aber auch, wie du das besser machen kannst.
Vermeide diese Fehler
1. Du arbeitest gegen deine Shooting Location
Manchmal habe ich das Gefühl, wir Fotografen führen einen kleinen Privatkrieg gegen unsere Umgebung – so, als ob die Stadt, das Dorf oder der Urlaubsort uns unbedingt ärgern will. Dabei ist es oft genau andersrum: Wir arbeiten gegen unsere Location, statt mit ihr.
Ich erinnere mich noch gut an einen Morgen in Lissabon, an dem ich unbedingt dieses eine sonnige, knallige Straßenfoto machen wollte. Du kennst dieses Gefühl sicher auch: Man hat ein Bild im Kopf und will es unbedingt genauso umsetzen.
Das Problem war nur, dass der Himmel an dem Tag aussah wie ein ungewaschenes graues T-Shirt. Null Drama, null Tiefe. Einfach nur platt. Und ich stand da, wild entschlossen, genau das Gegenteil zu fotografieren. Tja… rate mal, wie gut das funktioniert hat.
Und neulich, als ich alte Schwarz-Weiß-Fotos angeschaut habe, wurde mir wieder bewusst, wie ich früher genau denselben Fehler gemacht habe. Ich wollte Sommer, bekam aber Winter. Ich wollte klares Licht, bekam matschiges Grau. Ich wollte Italien, bekam Hamburg bei Nieselregen.
Statt die Location anzunehmen wie sie ist, habe ich dagegen angekämpft – und das schluckt jede Menge Energie.
Irgendwann habe ich mir gedacht: Was wäre, wenn ich einfach mal nachgebe? Wenn ich mich nicht beschwere, sondern das nutze, was eh schon da ist? Diese langweiligen, grauen Tage? Perfekt für harte Schatten, grobkörnige Schwarz-Weiß-Stimmung, ein bisschen Grit, ein bisschen Drama.
Genau das hab ich dann gemacht. Nicht unbedingt meine übliche Art zu fotografieren, aber plötzlich hat die Stimmung der Stadt zu meiner Stimmung beim Fotografieren gepasst. Und das Ergebnis hat mich echt überrascht.
Genauso läuft’s im Sommer. Ich sehe ständig Leute, die im Urlaub am Mittag losziehen und dann enttäuscht sind, weil die Sonne knallt wie eine Discokugel und jedes Porträt aussieht, als hätten sie gerade ein Hitzeabenteuer überstanden.
Aber Sonnenaufgang? Sonnenuntergang? Nee, das passt nicht in den Urlaubsrhythmus. Dabei weißt du selbst: Wer goldenes Licht will, muss zu goldenen Zeiten raus. Da hilft kein Wunschdenken.
Und dann gibt’s da noch die Klassiker: Leute, die ihre eigene Umgebung langweilig finden. Wohnst du auf dem Land, träumst du von der Großstadt. Bist du in der Großstadt, sehnst du dich nach Ruhe und Natur. Das Gras ist halt immer grüner auf der anderen Seite.
Ich habe mal eine Weile in einer Kleinstadt fotografiert und dachte zuerst: „Was soll ich hier denn machen? Hier ist ja nix los!“ Tja, bis ich gemerkt habe, dass „nix los“ eigentlich total viele Geschichten bedeutet.
Das morgendliche Erwachen im Dorf hat seinen ganz eigenen Charme. Da fotografierst du nicht Menschenmassen, sondern die Schuhe vor der Haustür, die Leiter unter dem Obstbaum, die Schatten an der alten Scheune. Das ist ein ganz anderer Vibe als in Berlin oder Paris – aber er ist genauso wertvoll.
Und das gilt selbst innerhalb einer Stadt. Will ich Menschen fotografieren, dann weiß ich genau, wo ich in München hingehe: Innenstadt, Hofgarten, Viktualienmarkt. Da pulsiert das Leben.
Will ich dagegen etwas Ruhiges, mehr Raum, mehr Atmosphäre, dann halte ich mich bewusst weg vom Trubel und suche diese kleinen Engstellen, die vergessenen Ecken, die Seitengassen. Jede Ecke erzählt eine andere Geschichte – aber eben nur, wenn ich bereit bin zuzuhören.
Am Ende ist es immer dasselbe: Wenn du gegen deine Location arbeitest, verlierst du fast immer. Wenn du mit ihr arbeitest, öffnet sich plötzlich eine ganze Welt an Möglichkeiten, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast.
2. Du arbeitest gegen dein Foto
Nicht nur während dem Fotografieren entsteht dieses Problem, sondern auch gerne danach. Ich sehe das regelmäßig bei der Bildbearbeitung.
Da sitzt jemand vor einem Foto, das eigentlich schon ganz klar sagt, was es sein will.
Ein klassisches Beispiel: Du hast ein Bild im Gegenlicht gemacht. Die Sonne ballert von hinten rein, die Schatten sind tief, die Lichter hart. Das Foto schreit förmlich nach Kontrast. Es will dramatisch sein. Ein bisschen düster, ein bisschen geheimnisvoll. Und was machen viele? Genau das Gegenteil.
Da wird erst mal alles aufgehellt, was man aufhellen kann. Lichter runter, Schatten hoch, Hauptsache alles schön gleichmäßig. YouTube hat’s schließlich so gesagt.
Aber du kennst das sicher selbst: Wenn man ein kontrastreiches Foto versucht glattzubügeln, dann landet man schnell in dieser grauen Matschsuppe. Das Bild verliert genau das, was es spannend gemacht hat. So, als hätte man ihm die Stimme weggenommen.
Ich hab das früher auch gemacht. Da saß ich vor einem Bild und dachte: „Na gut, so bearbeitet man halt Fotos, oder?“ Und plötzlich war das Ding komplett flach, so ohne Kraft, ohne Punch.
Erst später habe ich gemerkt, dass man einem Foto nichts aufzwingen sollte, nur weil man denkt, es müsste genau so gemacht werden, wie man das in einem Tutorial gesehen hat
Heute lasse ich die Schatten auch gern mal einfach schwarz. Komplett. Wenn sie keine wichtige Info enthalten, dann dürfen sie ruhig absaufen. Das bringt viel mehr Tiefe rein. Mehr Stimmung. Das Bild fühlt sich dann echter an.
Und wenn ich schon weiß, dass das Licht krass war, dann gehe ich eben mit. Ich drücke die Stimmung nicht weg, ich verstärke sie. Ich arbeite mit dem Foto, nicht dagegen.
Und das funktioniert auch anders herum. Wenn ich eine Szene fotografiere, die von Natur aus flach ist – wenig Licht, wenig Farbe, alles eher gedämpft – dann wird daraus kein knalliges Hochglanzfoto, egal wie sehr ich an den Reglern drehe. Das wäre, als würde ich einem Goldfisch beibringen wollen, zu klettern. Kann man machen, aber es endet selten gut.
Manchmal ist gerade diese stille, unscheinbare Grundstimmung das Beste am Foto. Dann ist es viel sinnvoller, diese Ruhe zu verstärken. Die zarten Töne zu lassen, wie sie sind. Die Welt nicht lauter machen, nur weil man glaubt, dass „kräftig“ automatisch besser bedeutet.
Und genau da liegt das Problem: Viele haben eine Vorstellung im Kopf – manchmal gelernt, manchmal kopiert – und versuchen dann mit aller Gewalt, jedes einzelne Foto da reinzuquetschen.
Egal, ob das Bild das möchte oder nicht. Als würde man es mit einem Brecheisen in eine Form drücken.
Aber ein Foto ist kein Gegner. Es ist eher wie ein kleiner Hinweis, der sagt: „Hey, ich bin schon da. Schau mich an. Ich zeig dir, wohin ich will.“ Wenn man sich diese Frage stellt – Was will dieses Bild eigentlich? – dann wird die Bearbeitung plötzlich viel einfacher. Und die Ergebnisse meistens auch viel stärker.
Kurz gesagt: Dein Foto arbeitet nicht gegen dich. Außer du zwingst es dazu.