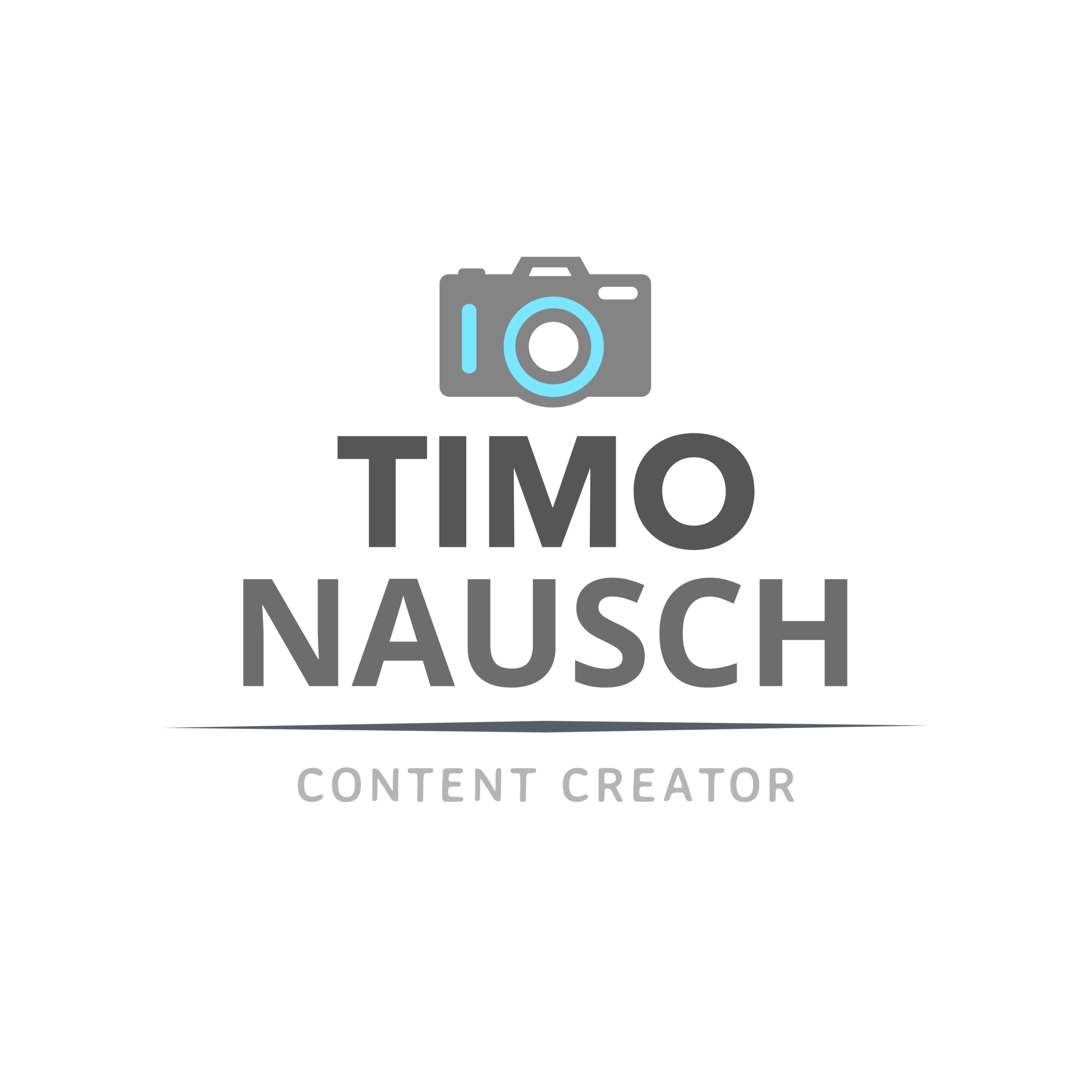Was Fotografen auch heute noch von Henri Cartier-Bresson lernen können
Henri Cartier-Bresson ist eine der größten Ikonen der Streetfotografie. Selbst andere Ikonen wie Joel Meyerowitz oder Fan Ho nennen Bresson als Vorbilder und Inspiration.
Wer genau ist also dieser Fotograf, der Streetfotografie geprägt hat, wie kaum ein anderer?
Wie Henri Cartier Bresson zur Fotografie gekommen ist
Geboren ist er 1908 in Chanteloup-en-Brie, aber seine eigentliche Heimat ist eine Mischung aus Paris und der Normandie. Seine Familie ist gut situiert – sein Vater ist Textilfabrikant – und das sorgt dafür, dass er als Kind viel Freiheit bekommt.
Freiheit, die er nutzt, um zu zeichnen, zu malen und die Welt zu beobachten. Genau diese Mischung aus Behütetsein und ständiger Neugier prägt ihn stärker, als er vielleicht selbst ahnte.
In Paris landet er auf dem Lycée Condorcet. Den Abschluss macht er zwar nicht, aber ganz ehrlich: für jemanden wie ihn war das Klassenzimmer wahrscheinlich sowieso zu eng. Er will Kunst, draußen, mit echten Menschen.
1926 beginnt er ein Malereistudium bei André Lhote. Lhote ist streng – sehr streng sogar. Geometrie, Komposition, klare Formen… das volle Programm. Und Cartier-Bresson saugt das auf wie ein Schwamm.
Wenn man heute über seine berühmte Kompositionsgenauigkeit spricht, ist das genau der Ursprung: Lhote hat ihm beigebracht, wie eine Szene gebaut sein muss, damit sie wirkt.
Trotzdem spürt man, dass ihm die Malerei irgendwann zu langsam wird. Die Surrealisten, damals überall in Paris spürbar, faszinieren ihn – dieses Spielen mit dem Zufälligen, dem Unvorhergesehenen, dem Moment, der plötzlich alles verändert.
1930 verschlägt es ihn dann in die Elfenbeinküste. Fast ein Jahr lang. Eine Reise, die eigentlich nicht als fotografisches Abenteuer geplant war. Und doch passiert dort etwas Entscheidendes: Er beginnt zu fotografieren. Noch halb spielerisch.
Three Boys at Lake Tanganyika von Martin Munkácsi
Aber dann sieht er 1931 in einer Zeitschrift das Foto Three Boys at Lake Tanganyika von Martin Munkácsi. Drei Jungen, die voller Leben ins Wasser rennen. Pure Energie. Pure Spontanität. Kein Kunstunterricht der Welt hätte ihm beibringen können, wie unfassbar kraftvoll ein einziger, eingefrorener Augenblick sein kann.
Er sagt später, dieses Foto habe ihm gezeigt, dass Fotografie das Leben „im Vorübergehen“ festhalten könne – und dass genau das seine Bestimmung sei.
Also kauft er sich 1932 seine erste Leica, eine unscheinbare kleine Kamera, mit der man sich unauffällig durch Straßen, Dörfer und Menschenmengen bewegen kann.
Das ist der Moment, in dem Cartier-Bresson eigentlich schon Cartier-Bresson ist. Die Leica wird zu seiner Skizzenbuch-Maschine. Sein Werkzeug für die spontane Intuition. Sein Schlüssel zur Streetfotografie.
Mit der Kamera zieht er durch Europa, oft mit Freunden, immer neugierig, immer suchend. Und auf einmal passiert das, was bei den meisten Fotografen viel später kommt: seine Bilder tauchen auf. In Magazinen, in Ausstellungen. 1933 hat er seine erste Ausstellung in New York – gerade mal 25 Jahre alt.
Sein Blick auf die Welt, den er als Kind entwickelt hat, seine strenge Kompositionsschule, der Einfluss der Surrealisten und schließlich dieser Befreiungsmoment mit der Leica – das alles führt ihn direkt dahin, wo er hingehört: auf die Straße, mitten ins Leben.
Dorthin, wo Bewegungen, Gesten, Blicke und Zufälle in Sekundenbruchteilen etwas erzählen, was keine Bühne und kein Studio so gut vermitteln könnte.
Wenn man so will: Er hat die Streetfotografie nicht gesucht. Sie hat ihn gefunden – in dem Moment, in dem er gelernt hat, das Leben nicht mehr zu inszenieren, sondern zu beobachten und auf den berühmten entschiedenen Augenblick zu warten, in dem Kopf, Auge und Herz auf einer Linie liegen.
Seine berühmteste Aussage: Der “Decisive Moment”
Es gibt wenige Interviews mit Cartier-Bresson. Einem Künstler in seinen eigenen Worten zuzhören, erklärt meist aber mehr, als hunderte Artikel die über ihn verfasst wurden. Eines der wenigen Interviews von ihm ist im Jahr 2000 veröffentlicht worden:
Wenn man Cartier-Bresson im Interview zuhört, merkt man ziemlich schnell: Beim decisive moment geht es nicht um Technik, nicht um Glück und schon gar nicht um irgendwelche fotografischen Regeln.
Für ihn ist dieser Moment eher etwas Philosophisches – eine Mischung aus Intuition, Sensibilität und der Fähigkeit, im richtigen Augenblick vollkommen präsent zu sein.
Er sagt einmal: „I don’t take the photograph, the photograph takes me.“
Und genau das ist der Kern. Er drückt nicht ab, weil er etwas will – er drückt ab, weil etwas ihn „erwischt“. Er lässt sich sozusagen fangen von dem, was vor seiner Linse passiert.
Was ich daran so spannend finde: Er betont immer wieder, dass man nicht wollen darf. Sobald du den Moment erzwingen willst, ist er weg. Der Kopf ist dann im Weg, sagt er. Denken sei „gefährlich“.
Stattdessen müsse man „receptive“ sein, empfänglich – wie ein Radar, das alles aufnimmt, ohne zu analysieren. Ich kenne dieses Gefühl gut: Du läufst durch eine Stadt und plötzlich merkt dein Körper schneller als dein Verstand, dass hier gerade etwas passiert, das ein Bild werden könnte. Ich verbinde damit das Gefühl von “Das könnte sich für ein Foto lohnen", das wirkt spannend”
An diesem Punkt kommt sein zweites großes Thema ins Spiel: Geometrie. Cartier-Bresson redet permanent davon. Er bezeichnet die Komposition als eine Art inneren Mechanismus, eine Art Reflex, der aus seiner Malereiausbildung stammt.
Für ihn gehört zum entscheidenden Augenblick immer auch die perfekte Ordnung im Chaos. Formen, Linien, Bewegungen – all das muss genau im selben Atemzug zusammenklicken. Sonst ist der Moment nicht vollständig.
Er beschreibt das als: „satisfy your eye“. Wenn das Auge zufrieden ist, weißt du, dass es der eine Moment ist. Also auch hier wieder keine klaren Regeln, sondern eher ein Gefühl, dass das Foto in der auslöst.
Seine Wurzeln in der Malerei werden aber an vielen Stellen deutlich. So sagt er zum Beispiel:
„Photography is just instant drawing.“
Zeichnen erfordert Meditation, Zeit, Stille. Fotografieren ist das Gleiche – nur eben in einem Bruchteil einer Sekunde. Als würde man die Welt im Vorbeigehen skizzieren, ohne sie festhalten zu wollen, sondern nur zu „empfangen“.
Der entscheidende Augenblick ist eigentlich kein Trick und schon gar kein Rezept. Es ist vielmehr eine Lebensweise. Eine Art, die Welt anzusehen. Offen, wach, neugierig – aber ohne Jagdinstinkt. Er sagt sogar, man müsse „in der Stille konzentriert sein“ – selbst mitten in einer Menschenmenge.
Und – wie er mit einem kleinen Stolz betont – Croppen ist verboten. Der Moment muss so geschehen, nicht anders. Das ist eine Form von Respekt: gegenüber der Szene, der Realität, dem Leben.
Wenn man all das zusammennimmt, wird klar, warum Cartier-Bresson Generationen von Streetfotografen geprägt hat. Der entscheidende Augenblick ist eine Sammlung aus vielen verschiedenen Ansätzen, die Bresson für seine Fotografie hatte:
Nicht zu viel wollen.
Nicht planen.
Mit allen Sinnen da sein.
Die Szene lesen.
Intuition entscheidet, nicht Analyse
Was viele jedoch falsch verstehen: Es geht nicht darum, nur ein einziges Mal, im perfekten Moment, auszulösen.
Wer sich die entwickelten Filme von Bresson ansieht, der erkennt schnell, wie viele Fotos er an einer einzigen Szene aufgenommen hat. Der entscheidende Moment entsteht dann eher rückblickend, wenn du aus diesem Fotoset die perfekte Aufnahme heraus isolierst, in der alle Elemente zusammenkommen.
Auswahlprozess von Henri Cartier Bresson
Wenn er dies erklärt, wird aber klar, welche Vergleiche er dabei zieht:
“The creative part of photography is very short. A painter can elaborate, a writer can, but as it’s given, we have to pick that moment, the decisive moment, if it is there.”
Als Fotografen hat man nicht dieselbe Zeit wie andere Künstler, um das perfekte Werk zu schaffen. Man muss einen Moment nehmen und diesen einfangen. Und um am Ende etwas bedeutsames zu erschaffen, muss dieser Moment eben der “perfekte” Moment sein.
Es widerspricht dem “Decisive Moment” aber auch nicht, wenn man mehr als ein Foto von einer Szene macht. Bresson warnt jedoch davor, zu viele Fotos zu machen. Denn das erschwert das Aussortieren und der perfekte Moment könnte genau zwischen zwei Aufnahmen eintreten.
Das ist aber auch darin begründet, dass Cartier Bresson auf Film fotografieren musste - und Serienbilder dadurch deutlich langsamer waren, als mit moderner Technik.
Zuschneiden verboten - Ein Widerspruch von Cartier Bresson?
Cartier-Bressons Haltung zum Croppen ist eigentlich glasklar: Für ihn war das Negativ heilig. Er sagt sinngemäß, dass ein Bild komplett sein muss – eine fertige Komposition, die im Moment des Auslösens entsteht und nicht erst später am Tisch.
Croppen? Für ihn fast schon ein Sakrileg. „No crop!“ – das betont er sogar ziemlich entschieden. Und man spürt dabei diese alte Schule der Malerei, die er nie abgelegt hat: Ein Bild ist ein Ganzes, kein Puzzle.
Aber – und das ist der spannende Teil – selbst der Meister hat sich nicht immer an seine eigenen Ideale gehalten. Seine berühmte Aufnahme des Mannes, der über die Pfütze springt, ist tatsächlich zugeschnitten.
Das ist insofern fast ironisch, weil gerade dieses Bild gerne als Paradebeispiel für seine „perfekte Komposition aus der Hüfte heraus“ herangezogen wird.
Cartier-Bresson verteidigte das später mit einer sehr praktischen Begründung: Er fotografierte durch ein Loch in einem Zaun. Er konnte weder näher ran noch anders komponieren.
Und am Ende war der Crop also keine faulige Rettungsaktion, sondern eine Art Notoperation, weil die äußeren Umstände ihm keine Wahl ließen.
Was man daraus lernt? Für ihn blieb Croppen trotzdem die Ausnahme, nicht die Regel. Ein Notfallwerkzeug – nicht der Plan.
Und ich sehe das ganz ähnlich. Wenn du dich beim Fotografieren dauerhaft darauf verlässt, dass du im Nachhinein schon alles geradeziehen kannst, wirst du irgendwann faul.
Die Kamera wird dann nicht mehr dein Werkzeug, und deine Einstellung zur Fotografie ist eher ein „wir richten das in Lightroom schon“. Und genau das killt diese wache, präsente Art des Sehens, die Streetfotografie eigentlich ausmacht.
Trotzdem wäre es albern, heute dogmatisch zu sagen: „Ein Bild darf niemals beschnitten werden.“ Wir leben nicht mehr 1932, und unsere Kameras haben Pixel ohne Ende.
Manchmal hast du zu weit ausgeholt und am Rand steht jemand, der aussieht, als wäre er aus Versehen ins Bild gelaufen, nur um dich später zu ärgern. In solchen Momenten kann ein Crop das Bild retten – oder ihm überhaupt erst die Klarheit geben, die du beim Fotografieren gespürt hast, aber nicht perfekt eingefangen hast.
Widerspricht das dem Kerngedanken des entscheidenden Moments? Vielleicht! Aber willst du am Ende ein gutes Foto wegwerfen, nur weil du es nicht zuschneiden willst? Ich würde es viel eher zuschneiden, etwas daraus lernen und versuchen, beim nächsten mal einen besseren Bildausschnitt zu wählen. Ganz so, wie es die großen Meister ja eigentlich auch getan hat.
Cartier-Bressons Grundgedanke bleibt aber wertvoll: Setz deinen Fokus lieber darauf, die Komposition schon in der Kamera zu finden.
Nicht, weil du ein Purist sein musst, sondern weil du dadurch anders siehst – klarer, entschiedener, bewusster. Das schult die Intuition ungemein.
Was Henri Cartier Bresson bei seiner Fotografie besonders wichtig war
Fotografie ist zutiefst menschlich. Um gute Bilder zu machen, reicht es nicht, die Kamera zu verstehen – wir müssen die Menschen verstehen. Wir müssen offen sein, warm, neugierig.
Ein Land, eine Situation oder ein Gesicht erschließen sich nicht im Vorbeigehen. Sie brauchen Zeit. Und sie brauchen eine Haltung, die nicht wertet, sondern zuhört. Wenn wir uns emotional öffnen, öffnen sich auch unsere Motive. Empathie wird dann zum unsichtbaren Teil unserer Bildsprache.
Wenn er Fotoprojekte in anderen Ländern hatte, hat er genau diese Aussage gelebt. Er hatte zwar ein Vorstellung der Menschen vor Ort, aber hat nie versucht diese zu bestätigen. Viel mehr ist er in das lokale Leben eingetaucht und hat dokumentiert, was er tatsächlich gesehen und gefühlt hat.
Trotz – oder gerade wegen – seiner Arbeit für internationale Magazine hielt Cartier-Bresson an einem weiteren Prinzip fest: Fotografiere immer zuerst für dich. Nicht für den Markt. Nicht für Erwartungen. Nicht für Anerkennung.
Geschichten müssen ehrlich bleiben, sonst verlieren sie ihre Kraft. Auftraggeber können den Rahmen definieren, aber nicht die innere Stimme ersetzen.
Erfolg kann sogar gefährlich sein, sagt er, weil er uns von uns selbst entfernt. Was zählt, ist nicht Applaus – sondern die Verbindung: dass das, was wir geben, wirklich angenommen wird.
All das führt zu seinem vielleicht zeitlosesten Gedanken:
Fotografie ist eine Art zu leben.
Unsere Bilder sind ein Spiegel dessen, wie wir fühlen, denken und uns bewegen. Die Kamera ist keine Barriere zur Welt, sondern eine Erweiterung unseres Auges – manchmal sogar unseres Herzens.
Wenn wir offen durchs Leben gehen, neugierig, wach und mit echter Freude an Begegnungen, dann werden unsere Fotos genau das transportieren. Nicht weil wir Regeln befolgen, sondern weil wir präsent sind.
Und vielleicht ist das die stärkste Inspiration, die wir von ihm mitnehmen können:
Fotografiere nicht, um Fotos zu machen. Fotografiere, um das Leben zu sehen.